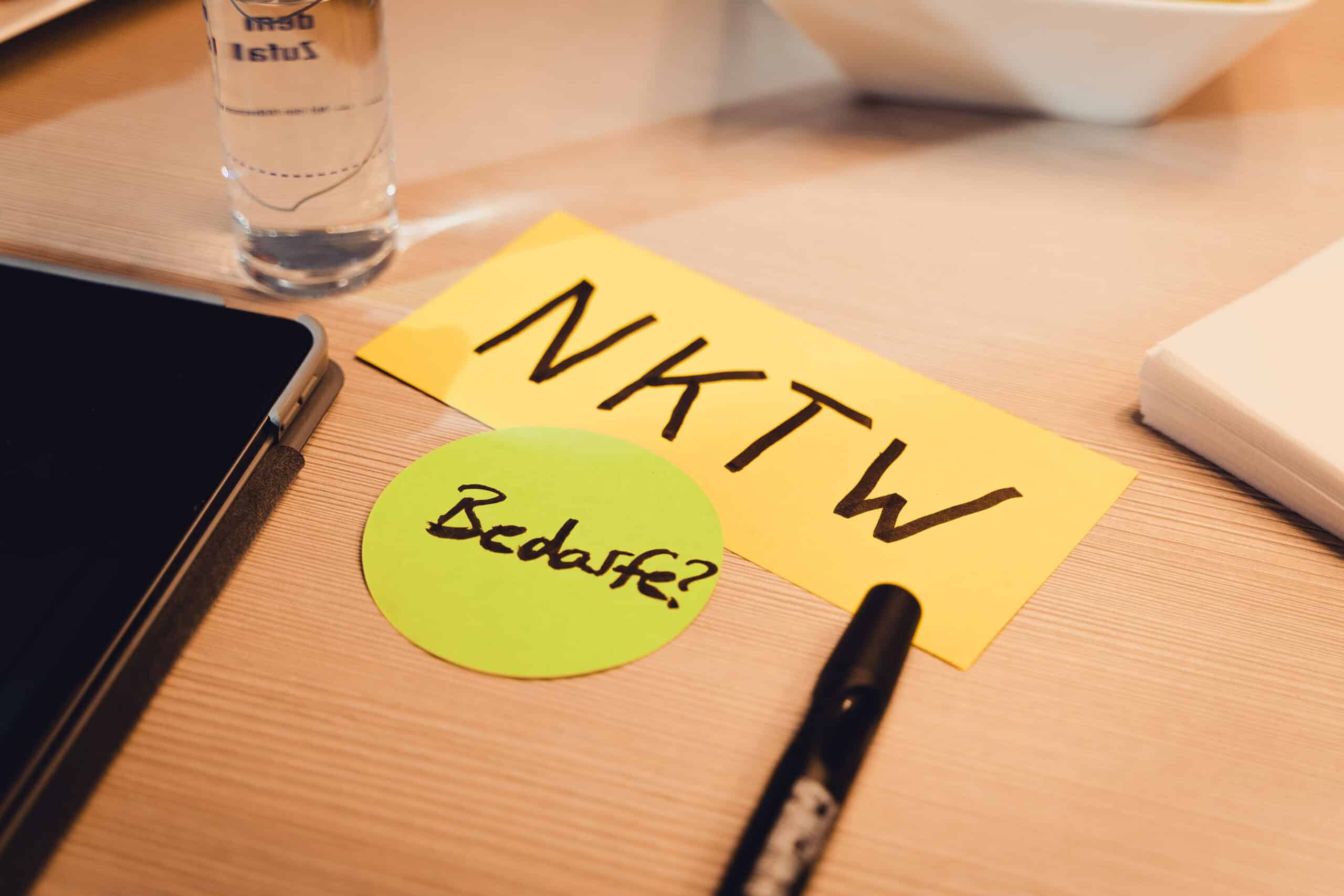Die Versorgung mit Löschwasser ist für die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und ihren Einsatzerfolg eine ausgesprochen kritische Komponente.
In den meisten Bundesländern sind die Gemeinden verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherzustellen.
In vielen Gemeinden existieren Außenbereiche, die nicht an das Trinkwasserleitungsnetz angebunden sind, sondern ihr Wasser für den eigenen Gebrauch aus privaten Zisternen und Brunnen beziehen. Die Löschwasserversorgung kann über diese Einrichtungen in der Regel nicht sichergestellt werden. Auch wurden in der Vergangenheit bei Baugenehmigungsverfahren im Außenbereich nicht konsequent Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gefordert.
Um der gesetzlichen Aufgabe zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung auch im Außenbereich nachzukommen, kann grundsätzlich auf drei Möglichkeiten zurückgegriffen werden.
Pendelverkehr (Organisatorisch)
Im Einsatzfall fahren die wasserführenden Fahrzeuge der Feuerwehr die Einsatzstelle an. Die Mannschaft des ersteintreffenden Löschfahrzeugs baut einen Löschangriff auf und nutzt hierfür initial das mitgeführte Löschwasser. Das Löschwasser der übrigen Behälterfahrzeuge wird in mobilen Faltbehältern zwischengelagert. Parallel hierzu kann eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken zu einer Entnahmestelle der abhängigen oder unabhängigen Löschwasserversorgung aufgebaut werden. Wird mehr Löschwasser benötigt, werden die Löschwasserbehälter der Einsatzfahrzeuge im Pendelverfahren an den Entnahmestellen befüllt und transportieren im Anschluss erneut das Löschwasser zur Einsatzstelle.
Der Nachteil an dieser Methode ist der hohe Bedarf an Fahrzeugen und Personal, der hohe Koordinationsaufwand und die reduzierte Systemverfügbarkeit bei langen Einsätzen.
Wasserversorgung über lange Wegstrecken (Organisatorisch-Infrastrukturell)
Bei der Wasserversorgung über lange Wegstrecken werden eine oder mehrere parallele Schlauchleitungen zur nächsten Löschwasserentnahmestelle verlegt. In Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit und Kapazität der Löschwasserentnahmestelle kann es erforderlich sein, Schlauchleitungen zu mehreren Entnahmestellen zu verlegen. Je nach Topografie, Ausgangsdruck und gewünschtem Förderstrom müssen dabei eine oder mehrere Pumpen zwischengeschaltet werden. Bei längeren Schlauchleitungen muss das Verfahren in der Regel mit dem Pendelverkehr kombiniert werden, um in den ersten Einsatzminuten über ausreichend Löschwasser zu verfügen.
Der Nachteil an dieser Methode ist die lange Zeitspanne und der hohe Aufwand für die Planung und Inbetriebnahme der Wasserversorgung über lange Wegstrecken.
Unabhängige Löschwasserentnahmestellen (Infrastrukturell)
Unabhängige Löschwasserentnahmestellen sind Entnahmestellen, die nicht an das Trinkwassernetz als abhängige Löschwasserversorgung angeschlossen sind, also von diesem unabhängig sind. Dies sind insbesondere:
- Löschwasserteiche
- Löschwasserbrunnen
- Unterirdische Löschwasserbehälter
- Entnahmestellen aus natürlichen Gewässern (Seen und Flüsse)
Überdies existieren oberirdische Löschwasserbehälter in Form von Tanks oder Kunststoff-Blasen, die zurzeit jedoch nicht genormt sind. Die einzelnen Entnahmestellen verfügen über unterschiedliche Vor- und Nachteile in Bezug auf Einrichtungskosten, Wartungsaufwand sowie Verfügbarkeit und Kapazität (z. B. bei Schnee und Eis oder in trockenen Sommermonaten). Werden Löschwasserentnahmestellen nicht regelmäßig gewartet und geprüft, ist die Nutzbarkeit im Einsatz häufig eingeschränkt.
Der Nachteil an dieser Methode sind die hohen Kosten, die für die Einrichtung und Unterhaltung einer flächendeckenden Löschwasserversorgung durch unabhängige Löschwasserentnahmestellen entstehen.
Löschwasserbereitstellungsstufen
Die drei Möglichkeiten zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung können in drei Löschwasserbereitstellungsstufen miteinander kombiniert werden.
In der Löschwasserbereitstellungsstufe 1 wird mit Schlauchleitungen bis maximal 300 Meter Länge geplant. Ein Pendelverkehr ist dann in der Regel nicht notwendig, entsprechend gering ist der Bedarf an Behälterfahrzeugen. Dafür entstehen hohe Kosten für Einrichtung und Unterhaltung von unabhängigen Löschwasserentnahmestellen.
In der Löschwasserbereitstellungsstufe 2 wird mit Schlauchleitungen bis maximal 700 Meter Länge geplant. Dies ermöglicht bei einem Ausgangsdruck von 10 bar und ebener Topografie einen Förderstrom von 800 l/min ohne das Zwischenschalten einer Pumpe. Hierbei muss ggf. ein Pendelverkehr eingerichtet werden, um die ersten Minuten des Einsatzes zu überbrücken. Im Gegenzug reduziert sich der Bedarf an unabhängigen Löschwasserentnahmestellen gegenüber der Löschwasserbereitstellungsstufe 1 deutlich.
In der Löschwasserbereitstellungsstufe 3 wird mit Schlauchleitungen bis 1.400 Meter Länge geplant. Dies ermöglicht bei einem Ausgangsdruck von 10 bar und ebener Topografie einen Förderstrom von 800 l/min mit dem Zwischenschalten einer zusätzlichen Pumpe. Aufgrund des deutlichen längeren Zeitfensters für Planung, Aufbau und die Inbetriebnahme einer solchen Leitung muss die erste Einsatzstunde fast vollständig mit Pendelverkehr überbrückt werden. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Behälterfahrzeugen, wohingegen der Bedarf an unabhängigen Löschwasserentnahmestellen niedrig ist.
Auch die rein organisatorische Sicherstellung der Löschwasserversorgung nur durch Pendelverkehr ist möglich. Hierfür wird in der Regel ein Großteil der kommunalen Behälterfahrzeuge gebunden. Bei längeren Einsätzen ist daher die resultierende niedrige Systemverfügbarkeit und der hohe Personal- und Koordinationsaufwand zu berücksichtigen.
Löschwasserkonzeption
Für die Konzeption einer bedarfsgerechten Löschwasserversorgung müssen die verschiedenen Löschwasserbereitstellungsstufen miteinander verglichen werden. Die Grundlage bildet eine Bestandsaufnahme der Löschwasserentnahmestellen sowie der kommunalen und benachbarten Behälterfahrzeuge. Mithilfe einer Analyse der räumlichen Verteilung der Entnahmestellen und der Kapazitäten im Pendelverkehr kann abgeleitet werden, welche der Möglichkeiten für die Kommune am geeignetsten ist. Anschließend kann der notwendige Investitionsbedarf in den Fuhrpark und in Löschwasserentnahmestellen geschätzt werden. Dies ermöglicht der Gemeinde zielgerichtete Investitionsentscheidungen zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung.
Fazit
Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Außenbereich stellt viele Kommunen vor komplexe Herausforderungen. Gerade dort, wo keine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz besteht, bedarf es individueller und tragfähiger Konzepte, um den Brandschutz rechtssicher und einsatztauglich zu gewährleisten. Dabei ist häufig keine der verfügbaren Maßnahmen – Pendelverkehr, lange Wegstrecken oder unabhängige Entnahmestellen – als alleinige Lösung ausreichend. Erst das abgestufte Zusammenspiel der Löschwasserbereitstellungsstufen ermöglicht eine wirtschaftlich vertretbare, organisatorisch machbare und technisch belastbare Löschwasserkonzeption.
Eine fundierte Bestandsaufnahme der vorhandenen Infrastruktur sowie eine systematische Analyse der Einsatzmöglichkeiten und -grenzen sind daher unverzichtbar. Auf dieser Grundlage kann die Kommune gezielte Investitionen tätigen – sei es in Fahrzeugtechnik, Pumpenkapazitäten oder die Ertüchtigung von Entnahmestellen. So entsteht ein belastbares Gesamtkonzept, das nicht nur der gesetzlichen Verpflichtung genügt, sondern auch die Einsatzsicherheit der Feuerwehr maßgeblich erhöht. Nur wer heute vorausschauend plant, stellt sicher, dass im Ernstfall auch morgen noch ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht.