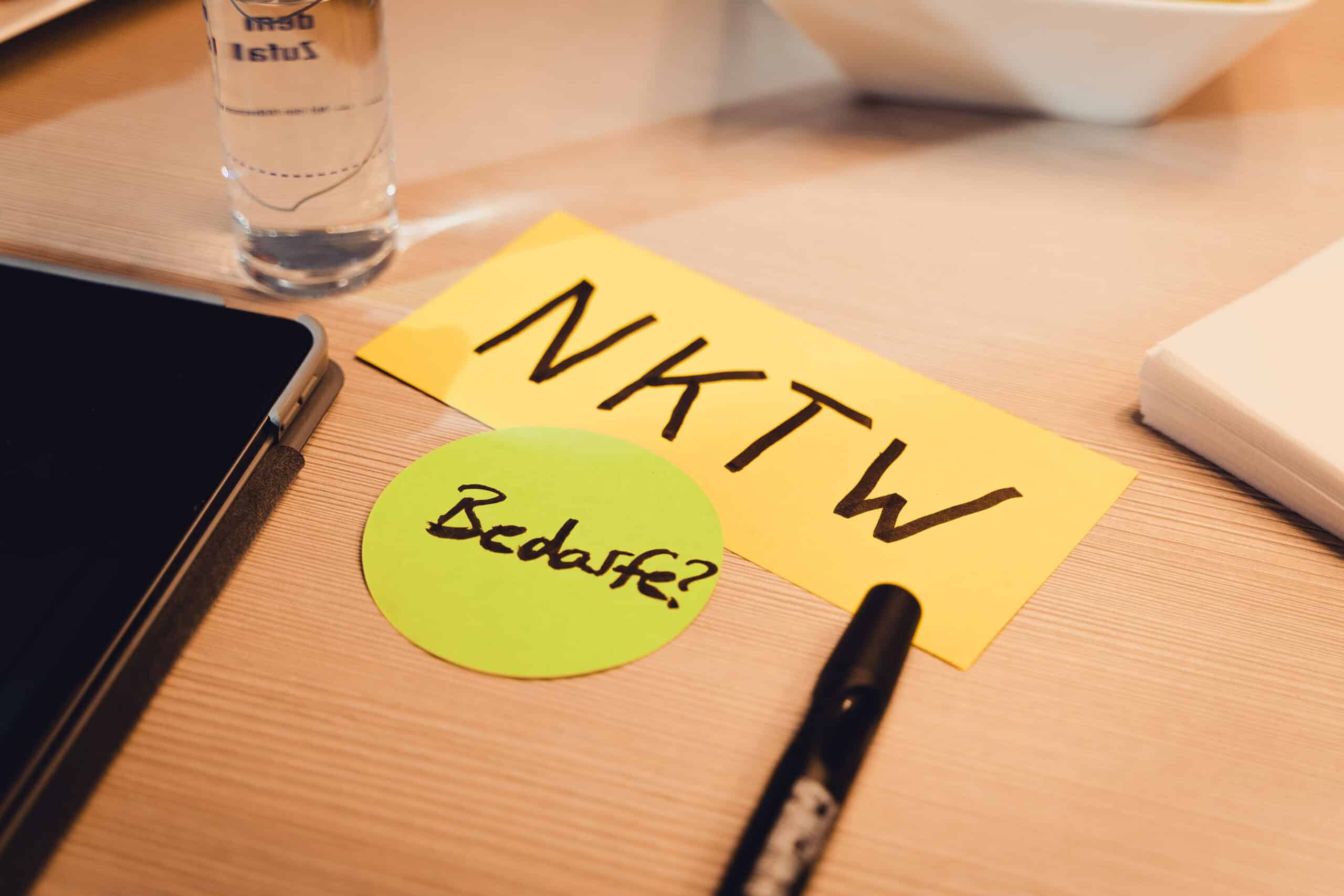Katastrophenschutzbedarfsplanung auf dem Prüfstand: Die vergangenen Jahre haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig eine strategisch fundierte Bedarfsplanung im Katastrophenschutz ist. In vielen Bundesländern besteht mittlerweile nicht nur ein deutlicher Bedarf, sondern auch eine gesetzliche Verpflichtung, Bedarfsplanungen im Katastrophenschutz zu erstellen. Dabei reicht es längst nicht mehr aus, lediglich deskriptive Beschreibungen der Aufgaben, seitenlange Kontaktlisten und Beschreibungen der vorgehaltenen Ausstattung zu dokumentieren. Vielmehr ist ein strategischer Ansatz erforderlich, der Bedarfe definiert und konkrete Umsetzungsmaßnahmen für die zuständigen Stellen aufzeigt.
Eine zentrale Schwäche der bisher etablierten szenariobasierten Methoden besteht darin, dass zur Ableitung von Planungszielen einzelne Szenarien isoliert und aufwendig betrachtet werden. Dies führt zu Ergebnissen, die zwar punktuelle Risiken sehr detailliert adressieren, aber kaum auf eine nachhaltige Stärkung des Gesamtsystems abzielen und die Wechselwirkungen zwischen den Planungsszenarien berücksichtigen.
Unsere Projekterfahrung zeigt, dass die Modellierung, Analyse und Auswertung von Planungsszenarien zwar sehr detailliert auf Basis von Referenzereignissen und Annahmen die möglichen Auswirkungen eines konkreten Szenarios abbilden, jedoch die Erkenntnis für die strategische Planung nur in geringem Rahmen einen Mehrwert zur Ableitung von Anpassungsmaßnahmen liefern. Ferner ist das derzeit häufig angewandte Verfahren zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz für die beteiligten Akteure häufig mit einem erheblichen Aufwand verbunden – unter anderem mit umfangreichen verwaltungsinternen Datenerhebungen und zeitintensiven Abstimmungsprozessen.
Das führt zu der Frage, ob der Aufwand der szenarienbasierten Betrachtung in einem angemessenen Verhältnis zu den Erkenntnissen steht.
Fokussierte Risikopriorisierung statt punktuelle Detailbetrachtung in der Katastrophenschutzbedarfsplanung
Diese Erkenntnisse haben den Anstoß für eine Weiterentwicklung der Herangehensweise gegeben, die auf der Methode der Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz basiert, diese jedoch praxisorientiert weiterentwickelt. Ziel ist es, eine ganzheitliche Planung zu ermöglichen, die alle relevanten Zuständigkeitsbereiche strukturiert berücksichtigt und den administrativen Aufwand minimiert.
Der entwickelte Ansatz basiert auf den wiederkehrenden Erkenntnissen früherer Projekte. Anstatt einzelne Szenarien isoliert zu betrachten, erfolgt eine umfassende Risikoanalyse, die alle relevanten Gefahren – von Naturereignissen über technische Ausfälle bis zu gesellschaftlichen Krisen – in den Blick nimmt. Ein zentrales Element des Ansatzes ist die effiziente Nutzung vorhandener Daten. Bereits existierende Datenbestände und öffentlich zugängliche Informationen werden gezielt in den Analyseprozess eingebunden. Durch dieses Vorgehen reduziert sich der Erfassungsaufwand für die Verwaltung erheblich. Ein strukturierter Datenkatalog sorgt dafür, dass ausschließlich die für die Planung relevanten Informationen berücksichtigt werden – eine Maßnahme, die nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität der Ergebnisse verbessert.
Im initialen Schritt werden die Rahmenbedingungen festgelegt. Hierbei erfolgen die Definition von Zuständigkeitsbereichen und Verantwortlichkeiten sowie die Einbindung aller relevanten Stakeholder. Diese Phase bildet die Basis des Projektes, indem sie einen detaillierten Zeitplan mit klaren Meilensteinen und abgestimmten Gremienläufen zur Ergebnispräsentation etabliert. Dadurch wird eine transparente und zielorientierte Zusammenarbeit sichergestellt, die den Grundstein für alle nachfolgenden Analysen legt, denn nur zur Umsetzung beschlossene Maßnahmen verändern das System nachhaltig.
Im Anschluss erfolgt eine zielgerichtete Datenerhebung, bei der der administrative Aufwand bewusst gering gehalten wird. Durch die Nutzung vorhandener Datenbestände und eine strukturierte Online-Abfrage werden essenzielle Informationen zum aktuellen Katastrophenschutzsystem gesammelt. Die so gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die spätere IST-Analyse, in der die bestehenden Strukturen und Ressourcen systematisch bewertet werden. Anhand von Kartenmaterial und der Darstellung vorhandener Planungen wird ein übersichtliches Bild der aktuellen Lage geschaffen, das als Ausgangsbasis für weitere Analysen dient.
Überblick verschaffen: Risikoidentifikation
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Ansatzes ist die Risikoidentifikation. Unter Anwendung des All-Gefahren-Ansatzes werden sämtliche potenzielle Gefahren systematisch erfasst. Die Analyse berücksichtigt dabei nicht nur Naturgefahren, sondern auch technische Gefahren und gesellschaftliche Auslöser. Durch die Einbeziehung lokaler Besonderheiten – wie Bevölkerungsdichte, Infrastruktureigenschaften und klimatische Gegebenheiten – wird sichergestellt, dass die Analyse individuelle Gefährdungen (räumliche Betroffenheit) und nicht nur mit einer allgemeinen Betrachtung auskommt. Ebenso wird bewertet, ob die weitere Betrachtung notwendig ist, da nicht aus jeder Gefahr ein für den Katastrophenschutz relevantes Risiko erwächst.
Risikopriorisierung: TOP 10 Risiken
Aufbauend auf der umfassenden Risikoidentifikation folgt eine Priorisierung der identifizierten Risiken. Ziel dieses Schrittes ist es, festzulegen, welche Risiken für die strategische Planung die relevantesten sind, um fokussiert zu planen und nicht möglichst breit, aber oberflächlich.
Anhand dieser Priorisierung werden konkrete Maßnahmen zur Risikominderung abgeleitet, die je nach Risiko auf die Reduktion der Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Begrenzung des Schadensausmaßes zielen.
Was brauchen wir und wie viel? Planungsziele in der Katastrophenschutzbedarfsplanung als zentrale Bewertungsgrundlage
Die strukturierte Festlegung konkreter, messbarer Planungsziele stellt die zentrale Stellschraube hin zu einer wirklich strategischen Planung dar. Denn es ist klar, dass es Anforderungen im Katastrophenschutz gibt, die völlig unabhängig von der konkreten Lage zentral für die Bewältigung sind.
Das Katastrophenschutzsystem muss übergreifend über Fähigkeiten verfügen, die nicht nur für ein konkretes Szenario notwendig sind. Es stellt sich in der Planung primär die Frage nach der konkreten zahlenmäßigen Auslegung. So ist es beispielsweise immer zentral, dass erprobte Führungsstrukturen etabliert sind, Kommunikationsmöglichkeiten jederzeit sichergestellt sind oder Versorgungs- und Unterbringungsinfrastruktur vorhanden ist.
In diesem Prozess werden die Ergebnisse der Risikoanalyse mit etablierten Standards und gesetzlichen Vorgaben kombiniert. Es erfolgt eine klare Definition der Anforderungen in zentralen Bereichen wie Führung und Kommunikation, medizinischer Versorgung, operativer Gefahrenabwehr sowie Kritischer Infrastruktur und Risikomanagement.
Hierbei werden die landesspezifischen gesetzlichen Grundlagen genauso berücksichtigt, wie Lessons Learned, Normen und Empfehlungen sowie Best Practices aus der Projekterfahrung.
Diese Planungsziele dienen als verbindliche Grundlage für die weitere Umsetzung und werden in einem SOLL-IST-Vergleich überprüft. Dabei wird der aktuelle Stand der vorhandenen Strukturen mit den definierten Zielen abgeglichen, um bestehende Defizite zu identifizieren und gezielte Optimierungspotenziale aufzuzeigen.
Mehrwert für die operative Umsetzung und politische Kommunikation der Katastrophenschutzbedarfsplanung
Schließlich mündet der gesamte Analyseprozess in die Ableitung konkreter Maßnahmen. Hierbei werden auf Basis der definierten Planungsziele spezifische Handlungsempfehlungen entwickelt, die in der Praxis umgesetzt werden können. Die Maßnahmen werden nach ihrer Dringlichkeit und Umsetzbarkeit priorisiert und mit klaren Zuständigkeiten versehen. Durch diese strukturierte Herangehensweise wird gewährleistet, dass die empfohlenen Maßnahmen nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch praktisch umsetzbar sind und den politischen Entscheidungsprozess unterstützen.
Der integrative Ansatz bietet in der Praxis zahlreiche Vorteile. Durch die ganzheitliche Risikoanalyse werden redundante Betrachtungen vermieden, sodass eine fokussierte Bewertung der wirklich relevanten Risiken möglich wird. Die effiziente Nutzung vorhandener Daten und der gezielte Einsatz moderner Online-Tools führen zu einer signifikanten Reduktion des administrativen Aufwands, was insbesondere für die Verwaltungsstrukturen der unteren Katastrophenschutzbehörden von großem Vorteil ist.
Durch die strukturierte Ableitung konkreter Maßnahmen werden nicht nur theoretische Planungen erstellt, sondern praxisrelevante Handlungsanweisungen entwickelt, die in der politischen Entscheidungsfindung und im operativen Einsatz einen echten Mehrwert bieten.
Fazit
Die Weiterentwicklung der Katastrophenschutzbedarfsplanung basiert auf der Projekterfahrung, dass die Betrachtung im Rahmen der szenarienbasierten Methoden bei großem Aufwand zu vorhersehbaren und häufig generischen Ergebnissen führt.
Die angepasste Vorgehensweise führt dazu, dass die Schritte hin zur Ableitung von konkreten Maßnahmen für die Anpassung des Katastrophenschutzes schneller und zielgerichteter erfolgen.
Dieses Konzept optimiert nicht nur den Ressourceneinsatz und reduziert den administrativen Aufwand, sondern schafft auch eine belastbare Grundlage für eine nachhaltige strategische Planung im Katastrophenschutz.
Es bleibt so mehr Kapazität, um Austausch- und Beteiligungsformate mit relevanten Akteuren (KRITIS-Betreiber, Kommunen, BOS) durchzuführen, um gezielt über Maßnahmen zur Risikoreduktion und Stärkung des Systems in den Austausch zu kommen.
Denn Ziel der Katastrophenschutzbedarfsplanung muss sein, das System unabhängig vom konkret eintretenden Szenario leistungsfähig aufzustellen, ohne die Behandlung der relevantesten Risiken außen vorzulassen.