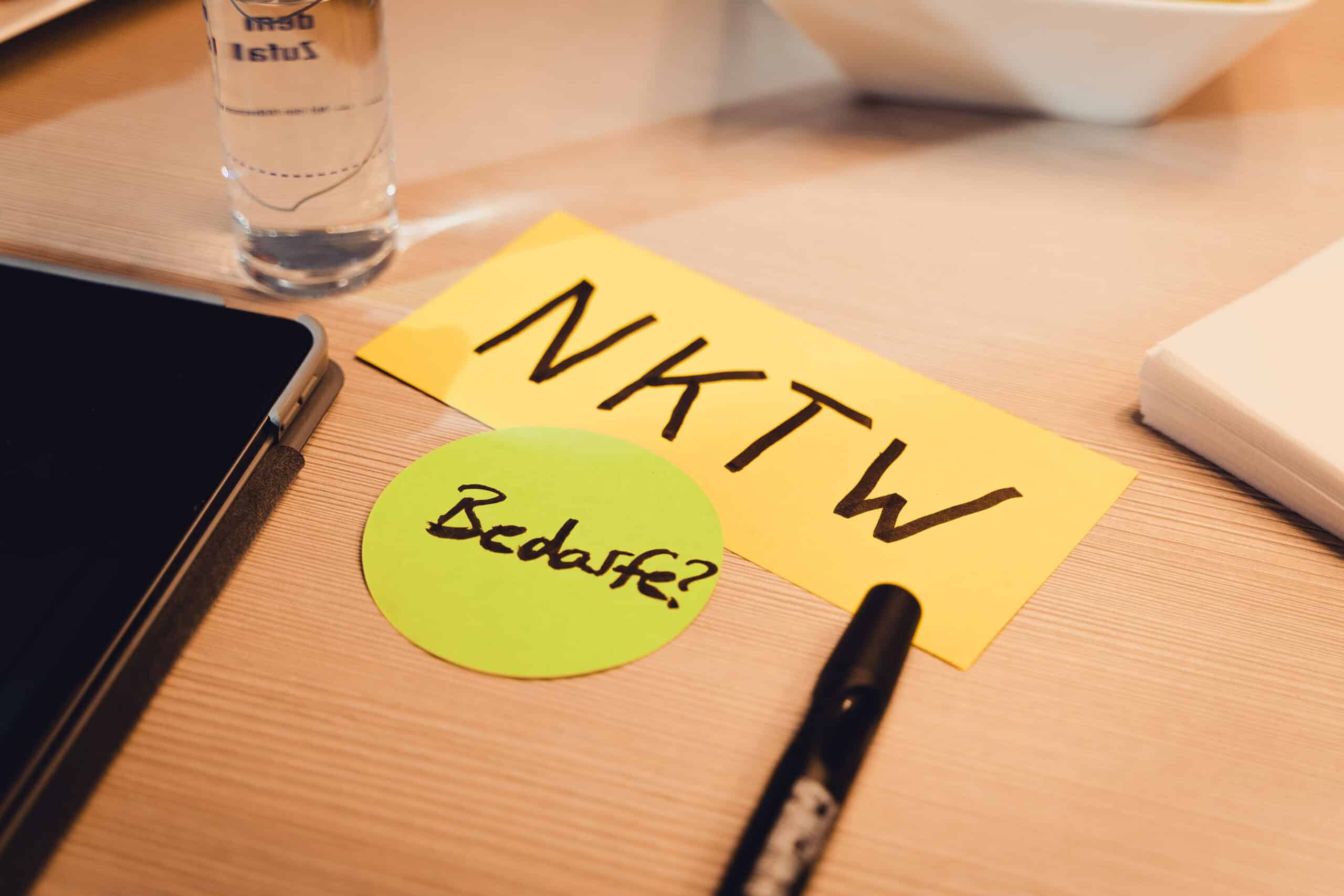Der demografische Wandel gehört zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Er führt zu einer alternden Gesellschaft und einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Laut dem Statistischen Bundesamt wird der Anteil der über 65-Jährigen in Deutschland bis 2060 auf über 30 % steigen, während die Gesamtbevölkerung langfristig von aktuell 84,7 Millionen auf etwa 74,5 Millionen abnimmt. Diese Entwicklung macht auch vor den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) keinen Halt.
Dringlichkeit
Die Dringlichkeit, auf diese Veränderungen zu reagieren, wird durch Studien wie „Wer löscht morgen?“ verdeutlicht. Diese Untersuchung beleuchtet die Zukunftsfähigkeit ehrenamtlicher Einsatzkräfte und stellt die zentrale Frage: Wenn die Freiwilligen Feuerwehren in ihrer jetzigen Struktur erhalten bleiben sollen, wie kann sichergestellt werden, dass sich auch zukünftig ausreichend Menschen für das Engagement gewinnen lassen? Bereits der Titel der Studie zeigt die Bedeutung dieser Problematik und die Notwendigkeit, bestehende Strukturen an die gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen.
Der demografische Wandel und die Gefahrenabwehr
Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Gefahrenabwehr sind vielschichtig. Sie betreffen den Fachkräftemangel, steigende Einsatzanforderungen sowie regionale und gesellschaftliche Herausforderungen.
Fachkräftemangel
Laut einer Untersuchung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird bis 2041 ein Drittel der heutigen Einsatzkräfte altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden – ein Verlust von rund 450.000 Personen. Besonders betroffen sind die Freiwilligen Feuerwehren, die bereits heute Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu gewinnen. Die demografischen Veränderungen verringern die Zahl der potenziellen Ehrenamtlichen und erschweren somit die langfristige Sicherstellung der Einsatzfähigkeit.
Steigende Einsatzanforderungen
m Rettungsdienst stieg die Zahl der Einsätze zwischen 2005 und 2022 um 60 % auf über 14 Millionen pro Jahr. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Nachfrage nach notfallmedizinischen Leistungen wider, die vor allem durch die alternde Gesellschaft bedingt ist. Der demografische Wandel erhöht insbesondere die Anforderungen an die geriatrische Notfallversorgung, da ältere Menschen häufiger medizinische Hilfe benötigen. Dies macht gezielte Schulungen und zusätzliche Ressourcen im Rettungsdienst unerlässlich, um den spezifischen Bedürfnissen dieser Zielgruppe gerecht zu werden.
Regionale Herausforderungen
Die Herausforderungen des Arbeitsmarktes machen auch vor den ehrenamtlichen Einsatzkräften nicht Halt. Eine Erhebung des Verbands der Feuerwehren NRW (2024) zeigt, dass etwa 30 % der Gemeinden Schwierigkeiten haben, die Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften sicherzustellen. Pendelnde Einsatzkräfte, die während der Arbeitszeit nicht verfügbar sind, und die Abwanderung aus ländlichen Regionen verschärfen die Problematik zusätzlich.
Gesellschaftliche Anerkennung
Zusätzlich zu den strukturellen Problemen steht auch die gesellschaftliche Anerkennung des Ehrenamts in der Diskussion. Laut BBK haben rund 70 % der Organisationen Schwierigkeiten, ehrenamtliche Stellen zu besetzen. Besonders anspruchsvolle Aufgaben wie Führungspositionen und spezialisierte Einheiten sind schwer zu besetzen, was die Einsatzbereitschaft langfristig gefährdet.
Lösungsansätze: Was Organisationen leisten können
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen, müssen Organisationen umfassende Strategien verfolgen, die sowohl auf die Gewinnung neuer Mitglieder als auch auf die Anpassung interner Strukturen abzielen. Die Nachwuchsarbeit spielt hierbei eine zentrale Rolle. Für Freiwillige Feuerwehren, die stark auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind, hat sich die Einbindung junger Menschen durch Kinder- und Jugendfeuerwehren als bewährter Ansatz erwiesen. So wird frühzeitig Interesse geweckt, Kompetenzen gefördert und langfristig eine Bindung aufgebaut.
Zudem liegt in der gezielten Ansprache neuer Zielgruppen großes Potenzial. Ergebnisse des Forschungsprojekts „Engagement & Freiwillige Feuerwehr/Wer löscht morgen?“ zeigen, dass Frauen, Migranten und Quereinsteiger bisher oft unzureichend berücksichtigt wurden, jedoch erheblich zur Sicherung der Einsatzfähigkeit beitragen könnten. Durch spezifische Kampagnen, Sprachkurse und interkulturelle Schulungen können Migranten besser integriert werden.
Die Digitalisierung eröffnet weitere Chancen, interne Prozesse effizienter zu gestalten. Mit KI-gestützter Personal- und Ressourcenplanung lassen sich Verfügbarkeiten optimieren und Engpässe minimieren. Digitale Lernplattformen ermöglichen flexible Weiterbildungen, die nicht nur Nachwuchskräfte gewinnen, sondern auch die Qualifikation bestehender Mitglieder stärken können.
Neben diesen organisatorischen Maßnahmen ist die gesellschaftliche Anerkennung des Ehrenamts ein wichtiger Faktor. Maßnahmen wie Ehrenamtskarten oder öffentlichkeitswirksame Kampagnen tragen dazu bei, die Motivation und Bindung der Freiwilligen langfristig zu fördern. Besonders für Freiwillige Feuerwehren ist es entscheidend, das Ehrenamt als unverzichtbare gesellschaftliche Aufgabe sichtbarer zu machen.
Strukturelle Maßnahmen auf politischer und regionaler Ebene
Auf politischer und regionaler Ebene werden verschiedene Ansätze diskutiert, um den Auswirkungen des demografischen Wandels gezielt entgegenzuwirken. Ein häufig thematisierter Punkt ist die Anhebung der Altersgrenze für Feuerwehrkräfte, wie sie derzeit in Nordrhein-Westfalen geprüft wird. Dabei wird eine Erhöhung von 60 auf 62 Jahre in Betracht gezogen, um den Personalbedarf kurzfristig zu entlasten und erfahrene Einsatzkräfte länger im Dienst zu halten. Nach aktuellen Schätzungen könnte diese Maßnahme den Personalbedarf um bis zu 13 % reduzieren. Vorgeschlagen wird zudem, die Einführung gestaffelt umzusetzen.
Zusätzlich wird die Einführung flexibler Ruhestandsmodelle diskutiert. Diese könnten es älteren Einsatzkräften ermöglichen, schrittweise in den Ruhestand zu wechseln, etwa indem sie administrative oder beratende Aufgaben übernehmen. So würde die wertvolle Erfahrung dieser Einsatzkräfte weiterhin genutzt, während gleichzeitig ihre Belastung reduziert wird.
Ferner wird auf die Bedeutung moderner Arbeits- und Ausbildungsbedingungen hingewiesen. Teilzeitregelungen, Homeoffice-Möglichkeiten und praxisnahe Ausbildungsmodelle, wie duale Systeme und digitale Lernplattformen, könnten die Attraktivität der Gefahrenabwehr steigern und die Effizienz der Ausbildungsprozesse erhöhen.
Fazit:
Zentrale Handlungsfelder für die Zukunft der Gefahrenabwehr
Der demografische Wandel zeigt deutlich, dass die Gefahrenabwehr nur zukunftsfähig bleibt, wenn ihre Strukturen an die veränderten gesellschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Die wesentliche Erkenntnis aus Untersuchungen ist, dass ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich ist, der auf organisatorischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene ansetzt.
Die zentralen Handlungsfelder lassen sich in drei übergreifende Themenbereiche gliedern:
✅ Nachwuchsgewinnung und Zielgruppenerweiterung
✅ Flexibilität und moderne Strukturen
✅ Politische und gesellschaftliche Unterstützung